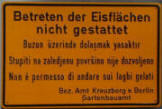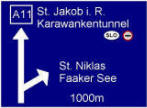|

Ortstafelstreit
Zur
Geschichte des Ortstafelstreites:
http://www.historisch.apa.at/cms/apa-historisch/dossier.html?dossierID=AHD_19720406_AHD0001
Umfassende Information unter:
http://www.ortstafel.at/
Sicht aus
der Gesetzeslage:
http://www.austria.gv.at/site/3515/default.aspx
27.
August 2006
Grandiose Lösung vom Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider.
Das die
etwas kleineren Ortstafeln diskriminierend sein sollten, ist glatter Unsinn.
Wenn diese Tafeln der StVO nicht entsprechen sollten, so sind sie nicht die
Einzigen.
|
Bin ich noch in Österreich oder
nicht? |
|
Das ist eindeutig. |
Die
untenstehenden Fotos wurden am 27. August 2006 im Tullner Feld aufgenommen und
diese Orte sind zu 100% deutschsprachig.
|
Michelndorf
B1 zwischen Tulln - St. Pölten |
Michelndorf
B1 zwischen Tulln - St. Pölten |
|
Hankersfeld
B1 zwischen Tulln - St. Pölten |
Weinzierl
B19 zwischen Tulln - Tausendblum |
29.
März 2006
Wenn ein
Führerscheinbesitzer eine Ortstafel im In- oder Ausland nicht als Ortstafel
erkennt, so gehört ihm der Führerschein entzogen. Eine Vorführung zum Amtsarzt
wäre anzuraten, da die "Verlässlichkeit" in Frage gestellt ist.
Verlässlichkeit ist die Voraussetzung zum Erwerb eines Führerscheines. Ist diese
Voraussetzung nicht mehr gegeben, muss von Amtswegen der Führerschein eingezogen
werden! Es gibt auch keinen Führerschein, der nur für bestimmte Orte gilt.
Verwunderlich ist, dass angeblich der Präsident des VGH dieses geistige
Fehlverhalten des Autolenkers als Anlass nimmt, die Debatte um die Ortstafeln
voranzutreiben.
Ein
Führerscheinentzug und eine saftige Verwaltungsstrafe für "Verarschung"
der Behörden ist eher angebracht.
18.
Jänner 2006
|
Ich kenne mich zwar geschichtlich zu
diesem Thema sicher nicht aus, aber im Artikel 7 steht nichts von Ortstafeln.
Im EU-Raum sind viele Grenzkontrollen
weggefallen, so tragen zweisprachige Ortstafeln beim Autofahrer sicher nicht zur
Klärung des eigentlichen Standortes bei. Wenn z.B. ein Tourist in eine Gegend
mit zweisprachigen Ortstafeln
nahe der Staatsgrenze kommt, so stellt sich ihm sicher die
Frage, in welchem Land er jetzt wirklich ist.
Um auf den Artikel 7 zurückzukommen. Im Abs.
3 werden
... Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur
... sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache verlangt. |
 |
Nachhilfe
für den VGH
|
Die
Topografie oder Topographie ist das Teilgebiet der Kartografie, das
sich mit der Vermessung, Darstellung und Beschreibung der Erdoberfläche und der
mit dieser fest verbundenen natürlichen und künstlichen Objekte befasst.
Hier ein Auszug aus Meyers Lexikon:
Die geographische Lage, bei
Siedlungsplätzen die großräuml. Verkehrslage, z. B. Küsten-, Ufer-, Passlage.
Die topographische Lage wird
dagegen von kleinräuml. Eigenschaften bestimmt, z. B. Berg-, Tal-,
Sporn-, Insellage.
|
Vereinfacht erklärt:
... Bezeichnungen und Aufschriften topographischer
Natur ...
Eine
Ortsbeschreibung findet nicht durch eine
Ortstafel statt. Eine Ortstafel ist auch keine Geländeskizze oder
Landkarte. Auf einer Ortstafel befindet
sich nur ein Namenwort, also der Name des Ortes, quasi ein Namensschild.
Namenschilder haben auch Feuerwehr und Bundesheer.
Abs. 3 bietet die Grundlage, um Abs. 4
erfüllen zu können (...
nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in
diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere
österreichische Staatsangehörige teil.).
Eine Beschreibung
ist etwas Erklärendes, eine Informationsquelle. Darunter sind zu verstehen
z.B.: Hinweisschilder, Informationstafeln, Warntafeln, Orientierungshilfen, usw. Diese Hinweisschilder, die es in deutscher Sprache
gibt, sollten in den entsprechenden Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des
Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder
gemischter Bevölkerung auch in slowenischer oder kroatischer Sprache
vorhanden sein.
Hinweisschilder (die etwas erklären):
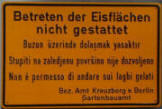  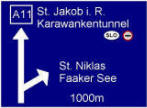


Eine Ortstafel gibt nur den Namen des Ortes an und erklärt nichts, auch nicht seine
topographische Natur (Eigenart).
Ihr persönlicher Name erklärt auch nichts, aber z.B.
ihre Berufsbezeichnung, Familienstand, Kontoauszug, usw. gibt Aufschluss über
ihre Person.
Aus dem RIS entnommenen Version
vom 25.10.2001
Artikel 7.
Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten
|
1.
|
Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und
kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark
genießen dieselben Rechte auf Grund gleicher Bedingungen wie alle
anderen österreichischen Staatsangehörigen einschließlich des
Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Versammlungen und Presse in
ihrer eigenen Sprache.
|
|
2.
|
Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder
kroatischer Sprache und auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener
Mittelschulen; in diesem Zusammenhang werden Schullehrpläne
überprüft und eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde wird für
slowenische und kroatische Schulen errichtet werden.
|
|
3.
|
In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des
Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder
gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroatische Sprache
zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. In solchen
Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften topographischer
Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in Deutsch
verfasst.
|
|
4.
|
Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und
kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark
nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in
diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere
österreichische Staatsangehörige teil.
|
|
5.
|
Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der
kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre
Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten. |
|
Der Kärntner
Ortstafelstreit
von APA - Austria Presse Agentur
|
Eigentlich wäre es 1972 "nur" um die
Erfüllung von Artikel 7, Punkt 3 des Staatsvertrages von 1955 gegangen:
"In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und
der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung
wird die slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen
als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen
und Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer oder
kroatischer Sprache wie in Deutsch verfasst."
Die Frage nach einer slowenisch-deutschen
Zweisprachigkeit der Ortstafeln in jenen Orten (Unter-)Kärntens, in
denen mehr als 20 Prozent der Bevölkerung slowenischer Muttersprache
sind, schlug aber hohe Wellen in Innenpolitik und Gesellschaft - und
sorgt auch mehr als 30 Jahre später noch immer für innenpolitische
Kontroversen. |

1972 lud Bundeskanzler Kreisky die Interessens-vertreter und
Bürgermeister
|
©
APA-IMAGES/ORF Fernseharchiv/Kern |
|
|
DIE VORGESCHICHTE
Schon zwischen den Jahren 1968 und 1972
war es vereinzelt zu "Schmieraktionen" seitens slowenischer Gruppen
gekommen, die ihr Recht durchsetzen wollten und die slowenischen
Ortsbezeichnungen in Nacht- und Nebelaktionen anbrachten.
Deutschnationaler Gegenpol zu den slowenischen Gruppierungen waren der
Kärntner Heimatdienst (KHD) und der Kärntner Abwehrkämpferbund, die
schon seit den 60er Jahren vehement vor einer kommunistischen
(=jugoslawischen) Bedrohung aus dem Süden im Form der Kärntner
Slowenischen Minderheit warnten.
Als Bundeskanzler Bruno Kreisky (S) und
der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Hans Sima 1972 begannen, nach einer
Lösung der Minderheitenfrage in Kärnten zu suchen, verschärfte sich der
Konflikt zwischen der deutschsprachigen Kärntner Mehrheitsgesellschaft
und der slowenischsprachigen Minderheit zusehends.
Als offizieller Beginn der
Ortstafelgespräche gilt der 6. April 1972. Der Rat der Kärntner Slowenen
und der Zentralverband slowenischer Organisationen sandten Vertreter zu
Gesprächen mit Bundeskanzler Kreisky nach Wien. Daraufhin wurde eine
Kommission gebildet, die "von nun an regelmäßig sämtliche mit der Frage
der Minderheiten in Kärnten zusammenhängende Probleme erörtern" sollte.
"Dieser Kommission werden außer dem Bundeskanzler die jeweils fachlich
betroffenen Regierungsmitglieder sowie Vertreter der Kärntner
Landesregierung und Sprecher der slowenischen Volksgruppen angehören",
berichtete die APA im Anschluss an das Treffen. |
 |
| Bundeskanzler
Bruno Kreisky begrüßt die Diskussionsteilnehmer. |
| © APA-IMAGES/ORF
Fernseharchiv/Kern |
| |
 |
| Ein Blick in
die Gesprächsrunde in Wien. |
| © APA-IMAGES/ORF
Fernseharchiv/Kern |
|
|
DER ORTSTAFELSTURM
Das Ortstafelgesetz, das von der
damaligen sozialistischen Mehrheit im österreichischen Parlament am 6.
Juli 1972 beschlossen wurde, sah topographische Aufschriften in
deutscher und slowenischer Sprache überall dort vor, wo mehr als 20
Prozent der Bevölkerung bei der Volkszählung 1971 Slowenisch als
Muttersprache angegeben hatten. Das Gesetz listete damals 205
Ortschaften auf, verteilt auf die Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt/Velikovec,
Klagenfurt-Land/Celovec-deela, Villach-Land/Beljak-deela und Hermagor/mohor.
Gleich nach der Aufstellung der ersten
zweisprachigen Schilder Ende September 1972 begann aber der so genannte
"Ortstafelsturm". Bis zum 10. Oktober 1972 - dem Jahrestag der Kärntner
Volksabstimmung von 1920, an dem sich die Mehrheit der Kärntner für
einen Verbleib Südkärntens bei Österreich entschieden hatte - gab es
praktisch keine zweisprachige Ortstafel mehr im Kärntner Unterland.
Am 14. Oktober begann die
Straßenverwaltung mit der neuerlichen Aufstellung - bis Ende des Jahres
wurden auch diese fast gänzlich gewaltsam entfernt oder die slowenischen
Aufschriften beschmiert. Die jugoslawische Regierung registrierte die
Vorgänge in Kärnten mit Besorgnis und forderte von Österreich die
Durchsetzung von Artikel 7 des Staatsvertrages.
DAS
VOLKSGRUPPENGESETZ
ÖVP und FPÖ sprachen sich gegen die
Gewaltmaßnahmen aus, forderten aber eine "geheime Spracherhebung", um
genauere Zahlen zur Größe der slowenischen Minderheit zu erhalten. Diese
"Volkszählung besonderer Art" wurde am 14. November 1976 im gesamten
Bundesgebiet durchgeführt. Auf Seiten der slowenischen Verbände traf die
"geheime Spracherhebung" als Voraussetzung für die Aufstellung von
zweisprachigen Ortstafeln auf große Ablehnung, da der Staatsvertrag
allen Minderheiten diese Rechte einräumte, ohne Berücksichtigung ihrer
tatsächlichen Größe. Ein bereits 1973 eingesetztes Kontaktkomitee sollte
zu einer Lösung des Gesamtkonfliktes in der Ortstafelfrage führen.
Das im Sommer 1976 erlassene
Volksgruppengesetz stellt eine Art Durchführungsverordnung für die im
Staatsvertrag verankerten Minderheitenrechte dar. In diesem von allen
Parteien im Parlament getragenen Gesetz wurde die so genannte
25-Prozent-Klausel festgelegt, wonach in allen Gemeinden, in denen sich
mehr als ein Viertel der Bevölkerung zur slowenischen Volksgruppe
bekannte, Ortstafeln in beiden Sprachen angebracht werden sollten.
Dadurch blieben nur mehr 91 Orte übrig, von denen im Endeffekt nur 60
zweisprachige Ortstafeln erhielten.
Die im Volksgruppengesetz
festgeschriebene Einrichtung eines Volksgruppenbeirates sollte der
Beratung der Bundesregierung und der Bundesminister in
Volksgruppenangelegenheiten dienen. Die beiden Slowenenverbände (der
christlich orientierte Rat der Kärntner Slowenen/Narodni svet korokih
Slovencev und der Zentralverband slowenischer Organisationen/Zveza
slovenskih organizacij na Korokem in der Tradition der Partisanen)
boykottierten diesen allerdings und erst 1989 wurde der Beirat
slowenischerseits beschickt.
Der Ortstafelstreit war damit aber nicht
zu Ende. Die 25 Prozent-Regelung wurde am 13. Dezember 2001 vom
Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Unter Berufung auf den Staatsvertrag
und die dort geregelten Minderheitenrechte setzten die Höchstrichter die
Grenze bei zehn Prozent fest. Die Umsetzung dieser Entscheidung ist
ausständig. Eine von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (V) im Jahr 2002
eingesetzte "Konsenskonferenz" blieb ohne Ergebnis. |

|