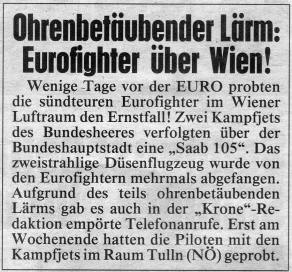|

|
3. Juni 2008
Herr und Frau Österreicher fühlten sich
gestört.
So mancher "Schattenparker"
oder besser gesagt Österreicher mit fehlendem
Nationalbewusstsein weiß noch immer nicht, dass wir
einen Luftraum haben, den es zu schützen und zu überwachen
gibt.
Auch der Herr Bundesminister für
Landesverteidigung, ein ehemaliger Zivildiener, musste zur
Kenntnis nehmen, dass es auf der Welt nicht nur zuckerlrosa
Mascherln gibt. So wird auch der Rest der Bevölkerung, die
es noch immer nicht verstanden haben, dazulernen müssen. Die
ältere Generation wird sich noch an unschöne Zeiten des
Weltkrieges und der Nachkriegszeit erinnern. Die junge Generation hat
sicher schon einige Filme aus dieser Zeit gesehen, aber wer diese
Zeit nicht selbst durchlebt hat, kann die heutigen Werte nicht
richtig |
|
beurteilen. Sie befinden sich in einem
aufgebauten und und friedlichen Österreich.
Die Frage ist, wer da anrief? Waren es die
älteren, die schon vergessen haben oder waren es die Jüngeren, die blauäugig
durch das Leben wandeln. Den Anrufern sei der unten stehende Text
empfohlen, um sich neu zu orientieren.
|
Anmerkung:
|
Schweiz
|
F-18C/D
Hornet
F-5E/F Tiger
II |
26 Stk.
44 Stk. |
|
Schweden |
JAS-39A/C/B/D |
146 Stk. |
|
|
Ungarn
|
JAS-39C/D
Gripen
MiG-29/UB
Fulcrum-A/B |
2 Stk.
10 Stk. |
|
Niederlande |
F-16AM/BM |
92 Stk. |
|
Wie sie sehen, sind beim Eurofighter die
2 Mantelstromtriebwerke Eurojet
EJ 200 mit einer Leistung
von je 6188 kg Schub (ohne Nachbrenner) und / je 9178
kg (mit Nachbrenner) keine Flüstertüte. Diese Leistung ist auch
notwendig, um nach 300 Meter als Startstrecke in 2,5 min auf 10.760 m
Höhe bei Mach 1,5, erreicht. Eine Leistung, die eine sinnvolle
Luftraumüberwachung erfordert.
|
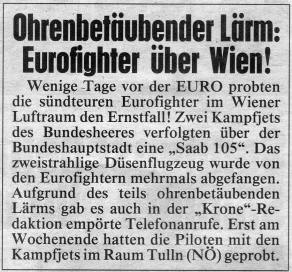
Kronenzeitung, 3. Juni 2008 |
Man muss dabei bedenken, dass bei der
Bereitschaftsmaschine am Boden, die Triebwerke abgestellt sind. Der Pilot
befindet sich in einem Bereitschaftraum. Im Alarmfall muss sich der
Pilot zur Maschine begeben, einsteigen, Helm, Sauerstoff, und G-Anzug am
Luftfahrzeug anschließen. Danach werden die Triebwerke angelassen. Das braucht
seine Zeit. Eine Zeit, die durch ausreichende Triebwerksleistung
eingeholt werden muss.
Wenn jemand auf die Idee kommt, der
Pilot könnte die ganze Zeit in seiner Maschine sitzen, dem sei
gesagt, das gab es nur fallweise im 2. Weltkrieg. Wir sind aber
nicht im Krieg!
|
Luftraumüberwachung
(cs/DER STANDARD,
Printausdgabe, 18.10.2006)
Die Sicherung des Luftraums gehört zu den
Grundaufgaben der Landesverteidigung – auch wenn sich das Bedrohungsbild
seit der Entwicklung früher Jagdflugzeuge geändert hat: Ging es
ursprünglich vor allem um die Abwehr von Bomberverbänden, später auch um
die Abwehr von Flugzeugen, die möglicherweise Atomwaffen trugen, so
steht in Friedenszeiten die luftpolizeiliche Aufgabe im Vordergrund.
Hierbei geht es nicht nur um den Schutz
der Neutralität, sondern auch um die Sicherung der Souveränität des
Landes: Niemand darf den Luftraum unbefugt benutzen.
Wenn ungewöhnliches Verhalten eines nicht identifizierten Flugzeugs
festgestellt wird – etwa ein Abweichen vom Kurs, eine plötzliche
Änderung der Kennung, ein Abreißen des Funkkontakts – wird von der in
einem Salzburger Bunker stationierten Einsatzzentrale eine Abfangjagd
befohlen. Typischerweise ergeht der Befehl dazu noch lange bevor ein
irreguläres Flugzeug den österreichischen Luftraum überhaupt erreicht
hat.
In Friedenszeiten geht es dann nicht darum, das eindringende Flugzeug
abzuschießen – dies wäre, entsprechende Bewaffnung vorausgesetzt, die
relativ einfachste Sache: Die Lenkwaffensysteme moderner Kampfflugzeuge
ermöglichen eine Bekämpfung gegnerischer Flugzeuge im relativ sicheren
Abstand von dutzenden Kilometern.
Aufwändiger ist es, einen Abfangjäger auf wenige Meter an ein Luftziel
heranzuführen, wie es allein im heurigen Jahr schon 150-mal vorgekommen
ist. Dazu müssen die Radarsysteme am Boden mit denen in den Flugzeugen
und mit den Flugmanövern des Piloten abgestimmt werden.
Um ein Foto aufzunehmen, das eventuellen diplomatischen Protesten
beigelegt werden könnte, kommt der Abfangjäger auf weniger als 100 Meter
an sein Ziel heran – was entsprechende Technik und Leistungsreserven
erfordert.
Wenn es erforderlich ist, ein fremdes Flugzeug zur Landung oder zum
Verlassen eines gesperrten Luftraums (etwa während einer
Sportveranstaltung oder eines Staatsbesuchs) zu zwingen, werden zwei
Abfangjäger an das Objekt herangeführt, wobei einer sich vor das fremde
Flugzeug setzt und der andere von hinten sichert.
|
|